SCHLAFAPNOE SCHNARCHEN
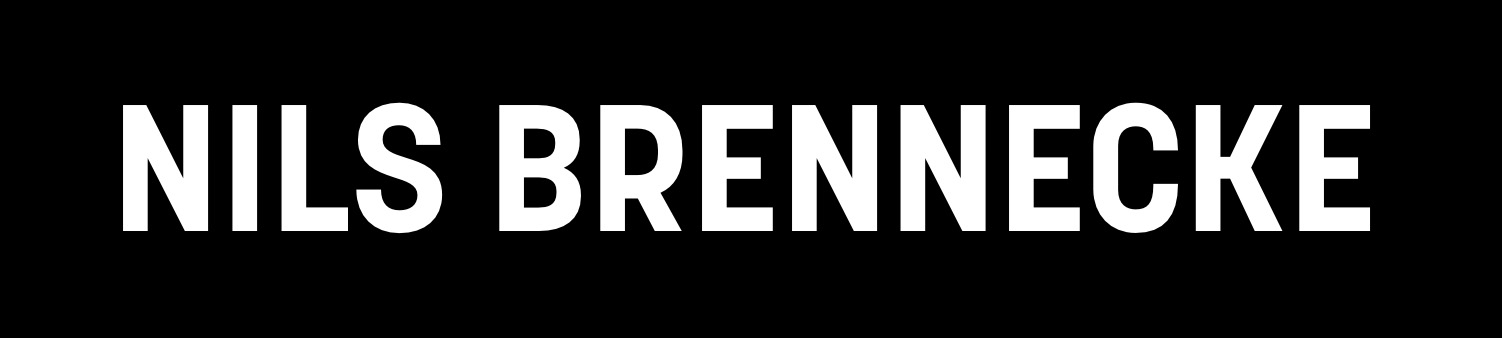
Die Ernährungspsychologie ist ein interdisziplinäres Feld, das sich mit den psychologischen Faktoren beschäftigt, die unser Essverhalten beeinflussen. Sie untersucht, wie Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und soziale Interaktionen unsere Ernährungsentscheidungen prägen. Ziel der Ernährungspsychologie ist es, ein besseres Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Psyche und Ernährung zu entwickeln, um somit gesündere Ernährungsgewohnheiten zu fördern.
Diese wissenschaftliche Disziplin integriert Erkenntnisse aus der Psychologie, Ernährungswissenschaft und Soziologie, um holistische Ansätze zur Verbesserung des Essverhaltens zu entwickeln. Dabei sollen nicht nur physische, sondern auch emotionale und mentale Aspekte der Ernährung berücksichtigt werden.
Unsere Psyche spielt eine zentrale Rolle, wenn es um das Thema Ernährung geht. Emotionale Zustände wie Freude, Trauer, Stress oder Langeweile können unser Essverhalten signifikant beeinflussen. So greifen viele Menschen beispielsweise zu ungesunden Snacks, wenn sie gestresst oder traurig sind, während sie in glücklichen Momenten eher bewusst und ausgewogen essen.
Das Gehirn steuert neben dem Hungergefühl auch signifikante Entscheidungsprozesse bezüglich unserer Nahrungsauswahl. Hormonelle Signale, die durch das Gehirn gesendet werden, vermitteln uns beispielsweise, wann wir hungrig oder satt sind. Diese Signale können jedoch durch emotionale und psychologische Faktoren verzerrt werden, was zu Fehlregulationen im Essverhalten führen kann.
Darüber hinaus besteht eine enge Wechselwirkung zwischen unseren Gewohnheiten und unserem psychischen Zustand. Ein tiefes Verständnis dieser Beziehung kann dabei helfen, psychologisch fundierte Strategien zu entwickeln, um das eigene Essverhalten positiv zu verändern und eine nachhaltige, gesunde Ernährung zu fördern.
Emotionen spielen eine wesentliche Rolle in unserem täglichen Leben und beeinflussen auch, was, wann und wie wir essen. Positive Emotionen wie Freude und Zufriedenheit können dazu führen, dass wir bewusster und gesünder auswählen, während negative Emotionen wie Traurigkeit, Ärger oder Langeweile oft dazu führen, dass wir zu weniger gesunden Lebensmitteln greifen. Diese emotionale Verbindung zum Essen kann dazu beitragen, dass wir in bestimmten Situationen mehr essen als nötig oder weniger auf die Qualität unserer Nahrung achten.
Studien haben gezeigt, dass Menschen in stressigen Zeiten eher dazu neigen, kalorienreiche und fettige Lebensmittel zu konsumieren. Dies liegt daran, dass bestimmte Lebensmittel die Produktion des Wohlfühlhormons Serotonin im Gehirn anregen, was uns kurzfristig besser fühlen lässt. Leider kann dieses Verhalten langfristig zu Übergewicht und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
Stressessen, auch emotionales Essen genannt, ist ein weit verbreitetes Phänomen, bei dem Menschen in stressigen oder emotional belastenden Situationen mehr oder ungesünder essen. Dieser Reflex wird oft durch das Bedürfnis ausgelöst, sich zu trösten oder kurzfristige Erleichterung von negativen Gefühlen zu erfahren. Stress und Anspannung können die Ausschüttung von Kortisol erhöhen, einem Hormon, das unseren Appetit steigert und das Verlangen nach zucker- und fettreichen Lebensmitteln erhöht.
Langfristiges Stressessen kann erhebliche gesundheitliche Folgen haben, darunter Übergewicht, Verdauungsprobleme und ein erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten. Es kann auch zu einer gestörten Beziehung zum Essen führen, bei der Nahrung primär als Bewältigungsmechanismus für emotionale Probleme genutzt wird.
Der erste Schritt zur Bewältigung von emotionalem Essen besteht darin, es als solches zu erkennen. Achten Sie bewusst auf Ihre Essgewohnheiten und versuchen Sie zu identifizieren, ob bestimmte Emotionen oder Stresssituationen Ihr Essverhalten beeinflussen. Tagebuch führen, in dem Sie festhalten, was und wann Sie essen, sowie Ihre Gefühle zu diesen Zeiten, kann hilfreich sein, um Muster zu erkennen.
Strategien zur Bewältigung emotionalen Essens umfassen das Entwickeln gesunder Alternativen zur Stressbewältigung. Dazu gehören körperliche Aktivitäten wie Spaziergänge, Yoga oder Sport, sowie Entspannungstechniken wie Meditation oder Atemübungen. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, sich Unterstützung durch Freunde, Familie oder professionelle Berater zu suchen, um emotionale Herausforderungen zu bewältigen, ohne auf ungesundes Essverhalten zurückzugreifen.
Indem Sie bewusste Entscheidungen treffen und alternative Mechanismen zur Stressbewältigung entwickeln, können Sie das emotionale Essen reduzieren und eine gesündere Beziehung zur Nahrung aufbauen.
Gewohnheiten entstehen durch wiederholtes Verhalten, das in einem spezifischen Kontext stattfindet und letztendlich automatisiert wird. Diese Routinen werden vom Gehirn als effiziente Methode verwendet, um Energie zu sparen und Entscheidungen zu vereinfachen. Wenn eine Handlung häufig genug wiederholt wird, verankert sie sich im Verhaltensrepertoire und wird zur Norm.
Die Neuropsychologie zeigt, dass das Basalganglien, ein Teil des Gehirns, der für die Steuerung von Gewohnheiten zuständig ist, bei der Entwicklung neuer Routinen eine zentrale Rolle spielt. Wenn wir eine Handlung oft genug wiederholen, wird sie zunehmend automatisiert und erfordert weniger bewusste Anstrengung, was sie zu einer festen Gewohnheit macht.
Auch unser Essverhalten wird stark von Gewohnheiten beeinflusst. Routinen wie feste Mahlzeiten, Snacks vor dem Fernseher oder der tägliche Kaffee am Morgen sind Beispiele für Essgewohnheiten, die unser tägliches Leben prägen. Diese Verhaltensmuster werden oft unbewusst und automatisch ausgeführt, unabhängig von unserem tatsächlichen Hunger- oder Sättigungsgefühl.
Gewohnheiten können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf unsere Ernährung haben. Gesunde Routinen, wie regelmäßige Mahlzeiten und das Konsumieren von Obst und Gemüse, unterstützen eine ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Ungünstige Gewohnheiten, wie häufiges Snacken oder das Essen von Fast Food, können hingegen zu Übergewicht und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
Das Durchbrechen ungesunder Gewohnheiten erfordert Bewusstsein, Planung und Geduld. Der erste Schritt besteht darin, sich der bestehenden Gewohnheiten bewusst zu werden und ihre Auslöser zu identifizieren. Notieren Sie, wann und warum Sie zu bestimmten Lebensmitteln greifen, kann helfen, diese Muster besser zu verstehen.
Eine effektive Strategie zur Änderung von Gewohnheiten ist der schrittweise Austausch ungesunder Routinen durch gesündere Alternativen. Anstatt beispielsweise Chips beim Fernsehen zu essen, könnten Sie gesunde Snacks wie Karottensticks oder Nüsse ausprobieren. Durch kleine, nachhaltige Änderungen können langfristige Gewohnheiten schrittweise umgestaltet werden.
Achtsamkeitstechniken und das tägliche Üben von Selbstreflexion können ebenfalls helfen, negative Essgewohnheiten zu identifizieren und zu überwinden. Indem Sie Ihr Essverhalten genau beobachten und bewusste Entscheidungen treffen, können Sie alte Muster durchbrechen und neue, gesündere Gewohnheiten entwickeln.
Zusätzlich kann die Unterstützung durch Freunde, Familie oder professionelle Berater hilfreich sein, um die Motivation zu erhöhen und Strategien zur Gewohnheitsänderung erfolgreich umzusetzen. Mit Durchhaltevermögen und dem richtigen Ansatz können Sie Ihr Essverhalten positiv beeinflussen und zu einem bewussten, gesunden Lebensstil beitragen.
Eine wichtige Strategie zur Verbesserung des Essverhaltens ist die Praxis der Achtsamkeit. Bewusste Ernährung bedeutet, sich voll und ganz auf das Essen zu konzentrieren, ohne Ablenkungen wie Fernsehen oder Handys. Durch diese achtsame Herangehensweise lernen Sie, die Signale Ihres Körpers besser zu verstehen und auf Hunger und Sättigung zu hören.
Genussvolles Essen hat ebenfalls eine bedeutende psychologische Komponente. Indem Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Mahlzeiten langsam und bewusst zu genießen, können Sie nicht nur die Geschmacksnuancen besser wahrnehmen, sondern auch ein insgesamt befriedigenderes Esserlebnis erfahren. Dies kann dazu beitragen, das Verlangen nach übermäßigem oder ungesunden Essen zu reduzieren.
Kognitive Verhaltenstherapien (KVT) bieten effektive Methoden zur Veränderung unerwünschter Essgewohnheiten. KVT konzentriert sich auf die Identifikation und Modifikation negativer Denkmuster, die das Essverhalten beeinflussen. Durch die Arbeit mit einem Therapeuten können Sie lernen, dysfunktionale Überzeugungen zu erkennen und positive, gesundheitsfördernde Gedanken zu entwickeln.
Verhaltenstherapeutische Ansätze beinhalten auch die Schaffung neuer Routinen und die Einübung gesunder Verhaltensweisen. Zum Beispiel könnte die Planung und Vorbereitung von Mahlzeiten im Voraus helfen, sich an eine gesunde Ernährung zu halten und Versuchungen zu vermeiden.
Für eine nachhaltige Veränderung des Essverhaltens ist es wichtig, langfristige Ziele zu setzen und realistische Erwartungen zu haben. Kleine, schrittweise Änderungen sind oft effektiver und nachhaltiger als drastische Diäten oder radikale Lebensstiländerungen. Ein schrittweises Vorgehen ermöglicht es, neue Gewohnheiten zu etablieren und beizubehalten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Selbstfürsorge und das Verständnis dafür, dass Rückschläge zum Veränderungsprozess gehören. Anstatt sich selbst zu kritisieren, können Sie Rückschläge als Lerngelegenheiten betrachten und Ihre Strategien entsprechend anpassen.
Nachhaltigkeit im Essverhalten bedeutet auch, soziale und umweltbewusste Entscheidungen zu berücksichtigen. Eine ausgewogene Ernährung, die sowohl den eigenen gesundheitlichen Bedürfnissen als auch den ökologischen Aspekten gerecht wird, trägt zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden bei und fördert ein positives Verhältnis zum Essen.
Bessere Ernährungsgewohnheiten langfristig aufrechtzuerhalten erfordert Geduld, Motivation und Unterstützung. Mit bewussten Entscheidungen und einem ganzheitlichen, psychologisch fundierten Ansatz ist es jedoch möglich, ein gesundes und nachhaltiges Essverhalten zu entwickeln und zu leben.
Wer übergewichtig ist, der hat auch meist mit lautem Schnarchen zu tun. Der Bettpartner oder die Bettpartnerin können ein Lied davon singen. Das Schnarchen bei adipösen Menschen ist oftmals auch ein Hinweis auf eine vorliegende Schlafapnoe, also Atemaussetzer im Schlaf. Diese Atemaussetzer können lebensgefährlich sein, da sie Bluthochdruck, Schlaganfall und Herzinfarkt auslösen können. Auch können sie bei Männern für eine Impotenz verantwortlich sein. Daher ist es insbesondere auch für diese Risikogruppe wichtig, nach der Diagnose Schlafapnoe eine Gewichtsreduktion vorzunehmen.
Nils Brennecke hat das Buch “Schlafapnoe Schnarchen – Wie ich die lebensgefährlichen Atemaussetzer in den Griff bekommen habe” geschrieben. Es ist im HaardtLine Verlag erschienen. Darin beschreibt er als Patient, wie er weit über 20 Jahre lang heftig schnarchte und von seiner Frau regelmäßig angestupst wurde, weil er längere Atempausen im Schlaf hatte. Nach der Diagnose Obstruktives Schlafapnoe Syndrom durch einen HNO-Arzt begann er sofort mit einer Diät. Autor und Patient Nils Brennecke (Jahrgang 1974) nahm 22 Kilo in nur fünfeinhalb Monaten ab. Dadurch konnte er seinen sehr hohen AHI (Wert der gemessenen Atemaussetzer pro Stunde) von 58,8 auf 24 senken. Durch eine parallele Therapie, unter anderem mit einem CPAP-Gerät, konnte er seinen AHI auf niedrige einstellige Werte abermals senken.
Das Buch “Schlafapnoe Schnarchen” beinhaltet neben wertvollen Ernährungsplänen des renommierten Ernährungscoachs Marcus Schall auch ein hoch interessantes Interview mit dem Würzburger Psychologen Prof. Dr. Andreas B. Eder über Gewohnheiten und Selbstkontrolle.
Der erfolgreichste Motivationstrainer Europas, Jürgen Höller, gibt in dem Buch Tipps, wie man sich nachhaltig selbst trainieren und motivieren kann, um alte Zöpfe abzuschneiden und somit ein besseres, gesünderes Leben zu führen.
Das Buch “Schlafapnoe Schnarchen – Wie ich die lebensgefährlichen Atemaussetzer in den Griff bekommen habe” sollte in keinem Haushalt fehlen.
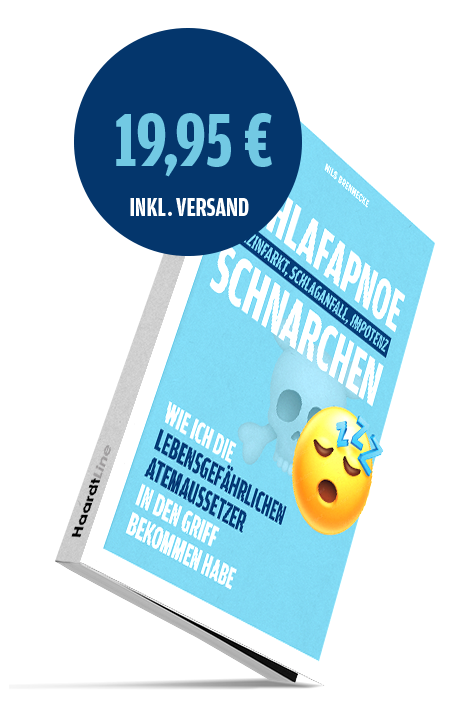

Woran du merkst, dass du im Schlaf lebensbedrohliche Atemaussetzer hast

Warum du als Schnarcher eher einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommst

Wie du das Obstruktive Schlafapnoe Syndrom in den Griff bekommen kannst